Adresse
ökoloco GmbH
Im Teelbruch 130
D-45219 Essen
Telefon +49 / 2054 860 320
Telefax +49 / 2054 860 32 99
Email hallo@oekoloco.de

Mittelerweile setzt mehr als jeder zweite Neubau auf eine Wärmepumpe für Warmwasser und Heizung. Das hat seinen Grund, denn Luftwärmepumpen nutzen Umgebungsluft als Energiequelle und sind damit CO2-neutral. Zudem machen sich Eigentümer unabhängig von schwankenden Energiepreisen. Wie genau das Heizen mit Luft funktioniert, Kosten, Förderung und Testergebnisse der Stiftung Warentest.
Es lassen sich zwei Arten von Luftwärmepumpen unterscheiden. Beide nutzen Umgebungsluft als Wärmequelle. Was sie unterscheidet ist, wie sie die Wärme im Haus verteilen:
Luft-Luft-Wärmepumpen haben den Vorteil, dass sie günstiger in der Installation sind. So benötigen sie weniger Infrastruktur in Form von Wasserleitungen und Wärmeverteilern. Da Luft jedoch Wärme schlechter speichert als Wasser, ist der Stromverbrauch höher als bei Luft-Wasser-Wärmepumpen.
Die Kosten für eine Luftwärmepumpe mit Einbau im Komplettpaket liegen zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Dabei sind Luft-Luft-Wärmepumpen deutlich günstiger als Luft-Wasser-Wärmepumpen, da sie keine Wasserleitung und Wärmeverteiler benötigen.
| Wärmepumpenart | Kosten | Mindesthöhe der BEG-Förderung ab 2024 |
|---|---|---|
| Luft-Luft-Wärmepumpe | Ab 8.000 Euro bis 16.000 Euro | 30% |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | Ab 12.000 Euro bis 21.000 Euro | 30% |
Die laufenden Kosten einer Luftwärmepumpe messen sich am Stromverbrauch. Zwar ist Umgebungsluft als Wärmequelle kostenlos, jedoch benötigt die Anlage zum Antrieb Strom.
In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern kommt eine Wärmepumpe auf einen Stromverbrauch zwischen 3.500 und 4.000 Kilowattstunden (kWh). Pro Monat entspricht das einem Verbrauch zwischen 292 und 333 kWh.
Bei einem aktuellen Strompreis von etwa 30 Cent die Kilowattstunde, liegen die monatlichen Kosten für eine Luftwärmepumpe demnach zwischen 88 und 100 Euro. Im Jahr kommen Eigentümer somit auf Stromkosten zwischen 1.050 und 1.200 Euro.
Energieversorger bieten spezielle Tarife für Heizstrom. Diese sind meist deutlich günstiger als Tarife für Haushaltsstrom.
Mit dem neuen Heizungsgesetz ändert sich ab 2024 auch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Demnach erhalten Eigentümer für den Einbau einer Luftwärmepumpe eine Förderung von mindestens 30 Prozent.
Diese Förderung lässt sich durch zusätzliche Boni bis maximal 70 Prozent weiter aufstocken. So erhalten Wärmepumpen, die ein klimafreundliches Kältemittel wie R290 nutzen einen zusätzlichen Zuschuss von 5 Prozent.
Einen Geschwindigkeits-Bonus von weiteren erhalten diejenigen, die ihre Wärmepumpe bis zum 31.12.2024 kaufen.
Zusätzliche 30% Prozent Förderung stellt der Staat Eigentümern zur Verfügung, deren zu versteuerndes Jahreseinkommen unter 40.000 Euro liegt.
Die Stiftung Warentest hat Luftwärmepumpen verschiedener Hersteller einem Test unterzogen. Insgesamt haben vier Modelle die Testnote „Gut“ erhalten:
| Modell | Testnote | Preis (ca.) ohne Installation |
| Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10 | 2,1 (Gut) | 18.700 € |
| Wolf CHA-10/400V | 2,3 (Gut) | 19.400 € |
| Stiebel Eltron WPL-A 07 HK 230 Premium | 2,4 (Gut) | 19.700 € |
| Vaillant Arotherm plus VWL 105/6 A S2 | 2,5 (Gut) | 16.900 € |
Hauptkriterien des Vergleichs durch die Stiftung Warentest war der Stromverbrauch, die Lautstärke und die Klimafreundlichkeit der einzelnen Modelle.
Luftwärmepumpen kommen auf eine Lebensdauer zwischen 15 und 20 Jahren. Wichtig für einen langen, störungsfreien Betrieb ist die regelmäßige Wartung.
Im Neubau gilt die Wärmepumpe zweifelsfrei als Schlüsseltechnologie für klimaneutrales Heizen.
Grundsätzlich arbeiten Luftwärmepumpen auch bei niedrigen Temperaturen von minus 15 Grad und weniger. Im Altbau ist es jedoch so, dass aufgrund der oft unzureichenden Dämmung viel Wärme verloren geht.
Um die Temperaturdifferenz zwischen Außen- und Innentemperatur zu überbrücken, benötigt die Wärmepumpe eine höhere Vorlauftemperatur. Das führt zu einem hohen Stromverbrauch. Ab einem gewissen Punkt das Heizen mit Luft weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll. Grundsätzlich muss für jedes einzelne Gebäude entscheiden werden, ob eine Wärmepumpe Sinn macht oder ob der Stromverbrauch zu hoch ausfallen würde.
Um auch bei niedrigen Temperatur im Altbau effizient heizen zu können, lässt sich eine Luftwärmepumpe mit einer weiteren Heizungsart kombinieren. Als Hybrid-Wärmepumpe ermöglicht die Kombination beispielsweise mit einer Gasheizung. Die Gasheizung springt immer dann an, wenn das Heizen mit Umgebungsluft wirtschaftlich keinen Sinn macht. Das ist vor allem im Winter der Fall, wenn die Außentemperaturen sehr stark absinken.
Diese bieten eine weitere Lösung, um eine Wärmepumpe im Altbau zu realisieren. Herkömmliche Wärmepumpen arbeiten bei Vorlauftemperaturen von bis zu 55 Grad Celsius effizient. Hochtemperatur-Wärmepumpen ermöglichen Vorlauftemperaturen bis zu 70 Grad Celsius. Damit lassen sie sich auch in Gebäuden mit wenig Dämmung und Heizkörpern einsetzen.
Um Luftwärmepumpen untereinander zu vergleichen zu können, eignen sich verschiedene Kennzahlen. Diese geben Hersteller für ihre Heizungsmodelle meist an.
Den Wirkungsgrad geben Hersteller in Prozent an. Dabei bedeutet ein Wirkungsgrad von 300 Prozent, dass ein Gerät aus einem Teil Strom die dreifache Menge Wärme gewinnt.
Der Coefficient Of Performance (COP) beschreibt das Verhältnis der gewonnenen Nutzwärme zu der eingesetzten Energie für den Antrieb der Anlage. Ein COP von 3 bedeutet, dass eine Luftwärmepumpe aus 1 kWh Strom 3 kWh Nutzwärme erzeugt.
Viel entscheidender ist jedoch die Jahresarbeitszahl (JAZ). Diese entspricht dem Mittelwert der erbrachten Leistungszahlen über den Zeitraum eines gesamten Jahres. Der COP hingegen misst die Effizienz unter Laborbedingungen.
Luft-Wasser-Wärmepumpen kommen unter guten Voraussetzungen auf eine Jahresarbeitszahl von 3. Luft-Luft-Wärmepumpen erreichen eine JAZ von 2,5.
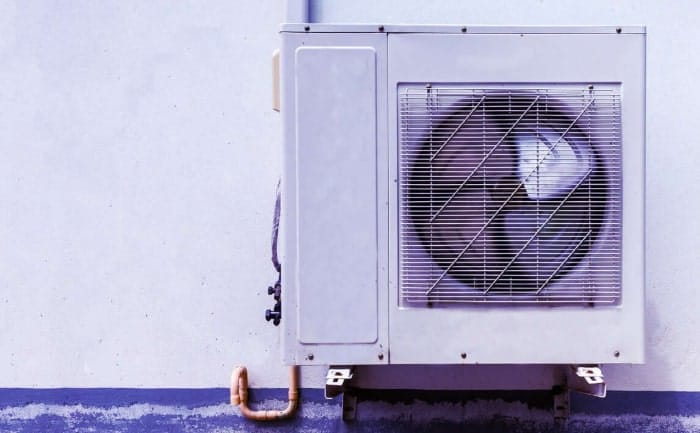
Je nach Standort und Bedingungen für die Luftwärmepumpen gibt es verschiedene Ansätze der optimalen Nutzung der Energie:
Bei Split-Geräten befinden sich alle Einheiten, außer Verflüssiger und Kältekreislaufkomponenten, in der Außeneinheit. Dadurch sparen Eigentümer Platz im Hausinneren. Hinzu kommt, dass Split-Geräte leistungsfähiger sind. Wen die Optik der Außeneinheit stört, dem bietet sich die Möglichkeit einer Verkleidung.
Monoblock-Geräte sind günstiger in der Installation. Sie kommen meist bei Gebäuden mit einer geringen Heizleistung zum Einsatz.
Vorteile
Nachteile
Vorteile
Nachteile
In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit 120 qm benötigt eine Wärmepumpe meist eine Leistung zwischen 5 und 10 Kilowatt (kW). Um die richtige Menge an kW zu berechnen, ermittelt ein Heizungsbauer nicht nur den Wärmebedarf, sondern er berücksichtigt auch die Leistung der Anlage.
Die Berechnung sollte unbedingt von einem Profi durchgeführt werden. Andernfalls bringt die Luftwärmepumpe zu wenig Leistung und das Haus wird nicht warm oder zu viel Leistung und Eigentümer verschwenden unnötig Energie.
Für den Gebrauch einer Luft Wärmepumpe sind im Gegensatz zu den alternativen Wärmepumpen Systemen keine Anmeldungen beim Landratsamt, der Kreisverwaltungsbehörde oder dem Wasserwirtschaftsamt notwendig. Lediglich die Bestimmungen bezüglich des Schallschutzes werden bei einer Installation überprüft. Die Schallemission ist abhängig von:
In Wohngebieten gilt es folgende Werte einzuhalten:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDie Stromkosten sind von der Energiequelle und somit der Luft abhängig. Neben dem gängigen Betrieb durch den Motor ist die Erwärmung der Energiequelle somit entscheidend. Folgend ein kleiner Überblick über die möglichen Leistungsarbeitszahlen, aus denen sich die Stromkosten bilden:
Der Stromverbrauch der Wärmepumpe lässt sich mittels einfacher Maßnahmen einfach senken:
Einige Fakten helfen bei der Kostenersparnis:
Der Gebrauch einer Wärmepumpe ist aufgrund der Nutzung von regenerativer Energie ein gutes Zeichen für den Umweltschutz. Fossile Brennstoffe und deren schädlichen Verbrennungsgase werden damit auf ein Minimum reduziert. Auch für diese technische Lösung der Heizung benötigt der Besitzer Strom – allerdings bei einer guten Luft Wärmepumpe lediglich ein Viertel, um eine Heizleistung von 100 Prozent zu erreichen. Allerdings muss bedacht werden, dass die Primärenergie meist von außen eingespeist wird. Hierbei kommt es auf den Lieferanten an. Mit einem Kohlekraftwerk als Produzenten der Exergie leistet der Besitzer einer Wärmepumpe überhaupt gar keinen positiven Beitrag zum Umweltschutz. Zudem wird die Effizienz unter der eines gewöhnlichen Heizkessels sinken. Alternativ stehen CO2-freundliche Mittel zur Verfügung:
Mit steigender Höhenlage sinkt die Regeltemperatur am Standort. Dies hat zur Folge, dass die Wärmepumpe eine größere Vorlauferhitzung realisieren muss. Und das steigert die Stromkosten für die zusätzliche Antriebsenergie. Des Weiteren wirkt sich beim Standort auch die Positionierung des Hauses zur Sonne aus. Am Berghang gen Norden wird sich die Bodenluft weniger erwärmen als Richtung Süden. Schon wieder werden Exergien die Kosten hochtreiben. Übrigens: Sie haben ein Recht auf Effizienz! Schließen Sie mit Ihrem Heizungsbauer einen Vertrag über die Mindestjahresarbeitszahl ab! Es gibt bei beiden Aufstellpositionen einiges zu beachten:
Generell empfiehlt sich der Gedanke einer Aufrüstung oder Modernisierung einer Heizungsanlage. Die entstehenden Kosten werden durch die jährlich reduzierten Ausgaben und Betriebskosten schnell ausgeglichen und wandeln sich in eine Ersparnis. Jedoch müssen Bestandsbauten nicht automatisch bei einer Integration einer Wärmepumpe komplett ausgetauscht werden. Diese Heizungsanlagen funktionieren meist mit niedrigen Vorlauftemperaturen sehr gut. In der Regel sind nur die Heizungsumwälzpumpen auszutauschen. Vorhandene Heizkörper oder die Optimierung auf Niedertemperatursysteme sind problemlos möglich. Luft-Wärmepumpen funktionieren nur dann einwandfrei und effektiv, wenn die äußere Gebäudehülle möglichst luftdicht abgeschlossen ist. Nur dann können die folgenden drei Aufgaben effizient genutzt werden:
Aufgrund der Betriebskosten und der Installation empfiehlt sich der Einbau bei Niedrigenergiehäusern. Bei Altbauten mit einer Heizlast über 10 Watt pro Quadratmeter wird die Inbetriebnahme schnell ineffizient.
Zu manchen Zeiten kann die Wärmepumpe – abhängig vom Standort – nicht unbedingt die komplette Heizleistung generieren. Für solche Situationen bieten sich Kombinationsmöglichkeiten der Heizungsarten an:
Photovoltaik
Die Anlage erzeugt circa 30-50 Prozent des benötigten Stroms zur Inbetriebnahme der Wärmepumpe.
Heizkesseltechnik
Die Spitzenlastzeiten in den kalten Monaten übernimmt die Brennwerttechnik von Gas- oder Öl-Heizung. Die Effizienz einer Luft-Wärmepumpe wäre sonst niedriger als diese Lösung.
Über den Autor
Bernhard Hoff
Bernd ist Betriebsleiter bei ökoloco. Er hat über 25 Jahren Berufserfahrung im Bereich Wärmepumpe und Öl-, bzw. Gasfeuerungsanlagen. Wenn Sie…
mehr
über Bernhard Hoff erfahren
Inhaltsverzeichnis
ökoloco GmbH
Im Teelbruch 130
D-45219 Essen
Telefon +49 / 2054 860 320
Telefax +49 / 2054 860 32 99
Email hallo@oekoloco.de
Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten
Erkundigen Sie sich über aktuelle Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten.
Ratgeber
Informative Artikel rund um das Thema Heizungen
Karriere
Bist Du verrückt genug, um bei uns zu arbeiten?
Ökoloco
ökoloco: Der Heizungsbauer Ihres Vertrauens
